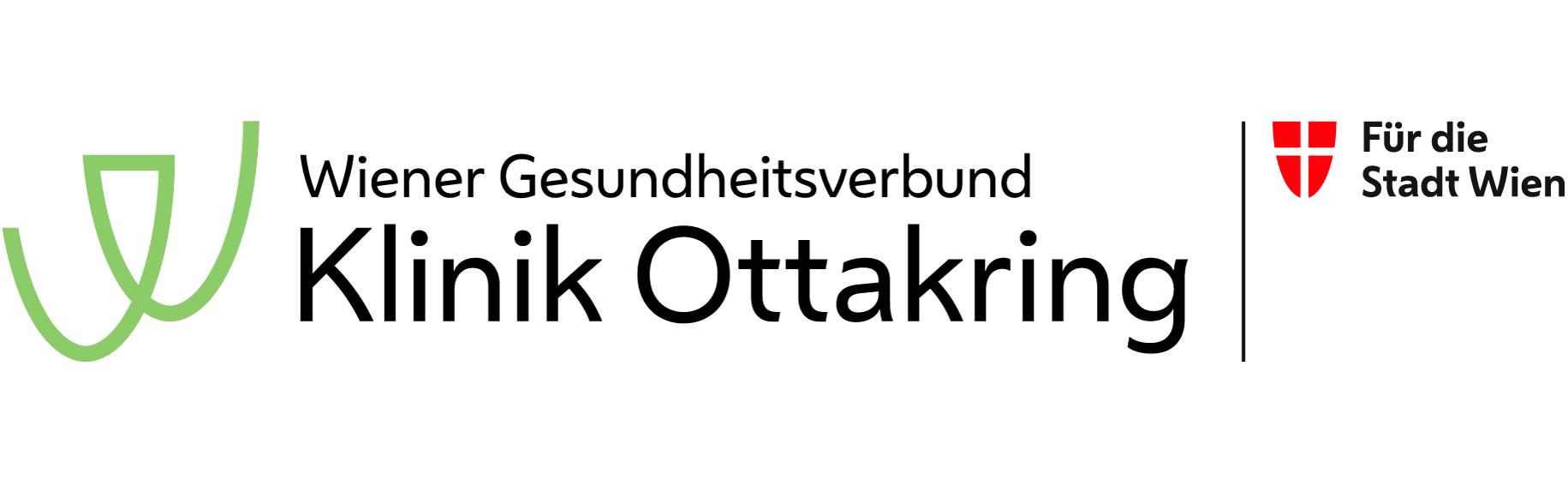Wenn Körper und Seele zusammengehören: Psychosomatische Medizin in der Klinik Ottakring
Krankheiten betreffen niemals nur den Körper – auch unsere Gefühle, Gedanken und Lebensumstände spielen eine wichtige Rolle. Genau hier setzt die psychosomatische Medizin an: Sie verbindet körperliche, seelische und soziale Aspekte (biopsychosoziales Modell), um Patient*innen ganzheitlich zu begleiten. In einem Gespräch mit Oberärztin Astrid Ladurner-Mittnik, Leiterin der Tagesklinischen Station für Säuglingspsychosomatik, werfen wir einen Blick darauf, was psychosomatische Medizin bedeutet und warum sie im Klinikalltag so wichtig ist.
Was versteht man unter psychosomatischer Medizin?
In der psychosomatischen Medizin betrachten wir den Menschen ganzheitlich und behandeln sowohl psychisch als auch organisch bedingte Symptome, die oft in einer komplexen Wechselwirkung zueinander stehen können. Wenn bei einer Abklärung keine körperliche Ursache gefunden werden kann, gilt es weiter zu denken. Die Expert*innen für Psychosomatische Medizin befassen sich mit eben diesen Wechselwirkungen zwischen Körper, Psyche und den sozialen Faktoren. Sie sind darüber hinaus Expert*innen in ihrem jeweiligen Fachgebiet (etwa Kinderheilkunde, Innere Medizin, Psychiatrie, Allgemein- und Familienmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie etc.). Die Abklärung der Symptome erfolgt dabei möglichst schonend und stets in enger Abstimmung mit den Patient*innen. Denn: Psychische Belastungen können auch körperliche Beschwerden auslösen und verstärken. Umgekehrt, können auch körperliche Erkrankungen die Psyche belasten.
Welche psychosomatischen Krankheiten gibt es?
Psychosomatische Krankheitsbilder äußern sich häufig durch körperliche Beschwerden, die durch psychische Belastungen, Stress, Angst oder Depressionen ausgelöst oder verstärkt werden können. Zu den häufigsten psychosomatischen Erkrankungen gehören Anpassungsstörungen, chronische Schmerzen unterschiedlicher Art, Depressionen, Essstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, wie etwa das Reizdarmsyndrom, somatoforme Störungen, Schlafstörungen und Verhaltensauffälligkeiten unterschiedlicher Art. Psychosomatische Symptome und Krankheitsbilder können über alle Altersgruppen von Baby bis ins hohe Alter hinweg auftreten.
Ganzheitliche Diagnose und individuelle Therapie
In einem fundierten Erstgespräch wird der Grundstein für eine vertrauensvolle Ärzt*innen-Patient*innen-Beziehung gelegt. Danach entscheidet die Ärztin bzw. der Arzt, welche Untersuchungen notwendig sind – stets nach dem Prinzip „So wenig wie möglich, so viel wie nötig.“ Es empfiehlt sich dabei eine stufenweise Abklärung, um unnötige Belastungen der Patient*innen zu vermeiden.
Je früher die Therapie beginnt, desto besser sind die Chancen auf Besserung und Vermeidung einer Chronifizierung des Krankheitsbildes. Ein zentraler Aspekt ist, dass Patient*innen ihre Körperwahrnehmung verbessern. Nur so können sie lernen ihre körperlichen Beschwerden auch selbstwirksam zu beeinflussen. Gemeinsam werden realistische, individuelle Ziele definiert wie etwa eine stabile Tagesstruktur, die Anpassung der Portionsgrößen oder das Ausmaß der körperlichen Aktivität. Durch diese schrittweise Vorgehensweise werden die Symptome nach und nach reduziert und damit mehr Selbstständigkeit im Alltag möglich gemacht.
Therapie auf Augenhöhe
Wichtig für den Therapieerfolg ist auch eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Diese schafft Vertrauen und fördert die Heilung. In der Psychosomatischen Medizin, die auf interdisziplinärer Zusammenarbeit beruht, kommen neben der Abklärung und Behandlung der organischen Korrelate verschiedenen Therapieformen wie Gesprächstherapie, Ergo- und Physiotherapie, Logopädie sowie Kunst- und Musiktherapie zum Einsatz. Auch medikamentöse Behandlungen werden angewendet. Gruppenangebote sind ein essentieller Baustein des Therapieangebots und bieten sozialen Rückhalt und Austausch. Die Diagnosestellung und Therapie erfolgt immer interdisziplinär, um den komplexen Bedürfnissen der Patient*innen gerecht zu werden.
Patient*in als Expert*in
Um Veränderungen in Gang zu setzen, müssen Patient*innen ihre Erkrankung und deren Zusammenhänge verstehen. Ziel der psychosomatischen Behandlung ist es, eine möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen – auch wenn nicht alle Krankheiten heilbar sind. Ähnlich wie bei chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes) steht die Integration des Erlebten/des Symptomes und das Erreichen von neuerlichem Wohlbefinden im Vordergrund.